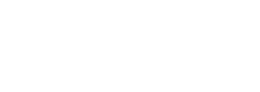lunatic Festival in Lüneburg erhält Bundesförderung
Gute Nachrichten aus Berlin: Das lunatic Festival hat sich erfolgreich um Mittel aus dem Festivalförderfonds des Bundes beworben. Mit diesen Mitteln werden insbesondere kleine und mittlere Musikfestivals bedacht, deren Fokus nicht nur auf der musikalischen Qualität, sondern auch auf gesellschaftlichen Aspekten wie Nachhaltigkeit, Bildungsarbeit und Diversität liegt.
Mit dem Festivalförderfonds gehen wir zum ersten Mal den Weg der strukturellen Förderung von Musikfestivals auf Bundesebene.
Dass sich das lunatic Festival als Non-Profit-Veranstaltung erfolgreich um diese Mittel beworben hat, ist eine tolle Nachricht sowohl für die Initiator*innen als auch für die Region! Das zeigt nicht nur, über welchen künstlerischen Wert das Festival verfügt, sondern würdigt auch den gesellschaftlichen Einsatz der Veranstalter*innen, für den ich ihnen danke und weiterhin viel Erfolg wünsche.
Finanzierung für Umkleide-Neubau des MTV Treubund gesichert
Gemeinsam mit dem Lüneburger Ratsherren und sportpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Philipp Meyn habe ich mich für eine Verlängerung der Förderung für einen dringend benötigten Neubau der Umkleide- und Funktionsräume der Sportanlage Hasenburger Grund eingesetzt.
Mit Erfolg: Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sowie der Projektträger Jülich und die Bauverwaltung haben sich jetzt auf eine Laufzeitverlängerung geeinigt. Damit kann die Errichtung des Ersatzneubaus der Umkleide- und Funktionsräume der Sportanlage Hasenburger Grund doch noch Realität werden.
"Ein Handeln ist dringend notwendig"
In der Hansestadt sind viele Projekte auf dem Weg, durch die aktuelle Situation konnte aber nicht alles zeitnah umgesetzt werden. Umso besser ist es, dass die Fördergelder für den Ersatzneubau der Sportanlage im Hasenburger Grund jetzt weiter zur Verfügung stehen. Erst vor Kurzem habe ich mir selbst ein Bild vom aktuellen Zustand der Anlage gemacht. Dabei ist klar geworden: Ein Handeln ist dringend notwendig. Damit Sport vernünftig ausgeübt werden kann, braucht es eine gute Ausstattung. Dafür setze ich mich gerne ein.
"Der Ersatzneubau der Kabinen- und Sanitäranlagen steht für eine Investition in Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft. Hier treiben wöchentlich über 1.000 Kinder und Jugendliche miteinander Sport. Die Sportanlage Hasenburger Grund besitzt auch für mich eine große persönliche Bedeutung. Als C-Jugendlicher habe ich im "Grund" beim MTV Fußball gespielt und die bereits damals rustikale bzw. sanierungsbedürftige Infrastruktur genutzt", sagt Philipp Meyn. Ratsherr Meyn weist zudem auf die Verantwortlichkeit der Stadt hin, die laut Ratsbeschluss nun aufgefordert ist, das Projekt prioritär anzugehen.
Für das Projekt Ersatzneubau der Umkleide- und Funktionsräume der Sportanlage Hasenburger Grund wurde Ende 2021 aus Mitteln des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen SJK ein Zuschuss in Höhe von einer Million Euro bewilligt. Der Bewilligungszeitraum war bis zum Ende dieses Jahres befristet.
Da in dieser Zeit vor allem die Organisation und Errichtung von Geflüchteten-Unterkünften kommunale Priorität gegenüber anderen Vorhaben hatten, konnte das Projekt jedoch nicht innerhalb des ursprünglich geplanten Zeitraums realisiert werden. Damit drohte die Förderung Ende 2023 zu verfallen.
Zahlreiche Lüneburger*innen diskutieren mit SPD über bezahlbaren Wohnraum
Die wohnungspolitische Konferenz der SPD im Landkreis Lüneburg ist auf großes Interesse gestoßen. Insgesamt 80 Bürger*innen haben am Montag im Utopia mit Fachreferent*innen über die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum diskutiert.
"Mit dem Thema Wohnraum haben wir das Thema der Zeit aufgegriffen und konnten augenscheinlich zahlreiche Menschen ansprechen“, sagte Karoline Feldmann, Co-Vorsitzende der SPD im Landkreis Lüneburg. "Wir sind froh, dass wir so viele Referent*innen für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Gemeinsam konnten wir über unsere Lösungen diskutieren und wichtige Perspektiven hinzufügen."
Neben den Referent*innen des Arbeitskreises Wirtschaft waren mit Zanda Martens MdB und Frank Henning MdL, Expert*innen von der Bundes- und Landesebene vor Ort, die mit ihren Keynotes inhaltliche Schwerpunkte setzen konnten. Anschließend wurde auf zwei Podien mit unterschiedlichen lokalen Fachleuten diskutiert.
Wir sind die Partei des sozialen Wohnraums
Als Co-Vorsitzender der SPD im Landkreis freut es mich, dass wir zahlreiche Themen – auch aus dem Publikum – aufgreifen konnten. Erbbaurecht, Mietsteigerungen und der Mangel an Boden: alles Dinge, die den Menschen aus der Stadt und der Region unter den Nägeln brennen. Mit der Veranstaltung haben wir einen wichtigen weiteren Schritt in der Debatte um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gemacht. Nun gilt es die Ideen in die Tat umzusetzen. Klar ist: Wir sind die Partei des sozialen Wohnraums – das ist auch bei dieser Veranstaltung wieder klar geworden.
Auf unserem Parteitag am 9. September 2023 hatten wir unsere Beschlusslage diskutiert und abgestimmt. Teil dieser sind fünf Maßnahmen zur Schaffung von neuem, bezahlbarem Wohnraum. Neben sozialem Wohnungsbau, der Senkung von Mietpreisen und Nutzung von Brachflächen sollen auch Investitionen durch die neu entstehende Landeswohnungsgesellschaft und die Vergabe von öffentlichen Grundstücken ausschließlich im Weg des Erbbaurechts für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen.
Wissenschaftliche Politikberatung: zwischen Forschung und innovativer Demokratie
In dieser Woche hat an der Leuphana-Universität Lüneburg der Tag der Fakultät Management und Technologie stattgefunden. Die Universität ist für die Stadt eine große Bereicherung – erst vor Kurzem wurde sie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Als Umweltpolitiker und Abgeordneten der Region freut mich das natürlich besonders.
Auch die Fakultät Management und Technologie ist einzigartig in Deutschland: Sie integriert seit ihrer Neugründung 2022 vier wissenschaftliche Disziplinen. Damit ist sie Vorreiter der Transformation. Ich bin überzeugt, dass diese Art der Zusammenarbeit die Zukunft ist. In meiner Arbeit im Bundestag erlebe ich jeden Tag, dass es das Fachwissen verschiedener Ressorts braucht, um gute, nachhaltige Gesetze zu schaffen.
“Wissenschaft sucht nach Wahrheit, während Politik nach Mehrheiten sucht” – das hat der Nachhaltigkeitsforscher Kai Niebert vor einigen Monaten im Gespräch mit der ZEIT gesagt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse wirken sich auf das Leben der Bevölkerung aus
Dass wissenschaftliche Beratung für die Politik unverzichtbar ist, hat uns in den vergangenen Jahren ganz besonders die Corona-Pandemie vor Augen geführt. Ohne das Expert*innenwissen aus der Forschung hätte sie noch viel schlimmere Konsequenzen gehabt, das ist sicher.
Die Pandemie hat die wissenschaftliche Politikberatung auch überhaupt erst in der breiten Bevölkerung sichtbar gemacht. Dazu haben die regelmäßigen Pressekonferenzen und öffentlichen Statements verschiedener wissenschaftlicher Akteure beigetragen. Das hat auch verdeutlicht, wie eng die sich immer wieder erneuernden Erkenntnisse und deren reale Auswirkungen auf das Leben der Bürger*innen verknüpft sind.
Wir brauchen die Arbeit der Wissenschaftler*innen, um politische Vorhaben im Gesetzgebungsprozess auf dem aktuellen Stand der Forschung gestalten zu können. Oft fungiert die Wissenschaft hierbei als eine Art Frühwarnsystem. In der Politik können wir wissenschaftliche Erkenntnisse aber nicht 1:1 umsetzen. Es gilt vielmehr, eine realistische Lösung im Sinne der verschiedenen Interessengemeinschaften zu finden. Denn es kommen oft rechtliche, ethische, soziale und natürlich auch wirtschaftliche Fragen mit ins Spiel.
Forschung sichert Legitimität politischer Entscheidungen
Nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit: Wir müssen die Transformation interdisziplinär begreifen. Das ist wichtig, in einer Zeit, in der die Transformation unserer Energieversorgung und unserer Wirtschaft hin zur Emissionsfreiheit tatsächlich Realität wird. In Gesprächen mit Bürger*innen merke ich immer wieder, wie dieser Wandel auch zu Sorgen und Abwehrhaltungen führt.
Hier sind meine Kolleg*innen und ich in der Politik gefordert. Wir müssen besser werden im Erklären und die Menschen mitnehmen auf dem Pfad der Veränderung. Zentral ist es dabei zu erklären, dass nachhaltiges Leben und Wirtschaften im Interesse jedes und jeder Einzelnen sind.
Wissenschaft muss nicht politisch sein, sie zeigt die Fakten auf, gibt Hinweise, spricht Warnungen aus. Wissenschaft trägt zu einer evidenzbasierten Politik bei. Wie die Friedrich-Ebert-Stiftung festgestellt hat, genießt die Wissenschaft im Vergleich zu Medien oder politischen Institutionen aber auch ein größeres Vertrauen in der Bevölkerung. Wenn wir in der Politik also ihre Expertise in unsere Gesetzgebung einfließen lassen, sichern wir damit auch die Legitimität politischer Entscheidungen.
Wissenschaftliche Politikberatung für eine starke Demokratie
Wissenschaftliche Politikberatung muss unabhängig sein, denn nur dadurch wird ihre Glaubwürdigkeit erhalten. Das bedeutet für uns Politiker*innen, auch mal unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren und in die eigene Arbeit aufzunehmen.
Mit der Klimakrise haben wir eine enorm große Herausforderung zu bewältigen, bei der ich mir persönlich mehr Tempo wünschen würde. Teil des Problems ist, dass Nachhaltigkeit oft nur ein Anhang von Gesetzestexten ist. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele im Gesetzgebungsverfahren muss endlich den Raum bekommen, den sie verdient. Dafür setze ich mich in meiner Arbeit ein und ich bin dankbar, meine Argumente dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen zu können.
Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft und bin überzeugt, dass Politik sie braucht. Nicht nur, um sich mit Fachwissen anzureichern, sondern auch um eine starke Demokratie zu schaffen. Denn die Antwort auf von Ideologie getriebene Hetze kann nur evidenzbasierte, transparente und Bürger*innen-nahe Politik sein.
Meine Rede zum Volkstrauertag
Heute durfte ich auf zwei Gedenkfeiern zum Volkstrauertag einige Worte sagen. Ursprünglich wurde er gegründet, um der Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu gedenken. Währen des Nazi-Regimes wurde er dann zweckentfremdet und in “Heldengedenktag” umbenannt. Ich bin froh, dass wir seitdem wieder an alle Opfer von Krieg und Gewalt erinnern, auch – oder vielleicht besonders – an die zivilen.
Wir dürfen eine erneute Vereinnahmung des Volkstrauertages von Rechts nicht zulassen. Dazu gehört es, die Verantwortlichkeiten Deutschlands im Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege nicht zu verschweigen.
Dieser Tage werden wieder Davidsterne an Wohnhäuser gemalt, israelische Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Gleichzeitig werden muslimische Gemeinden unter Generalverdacht gestellt und so getan, als sei Antisemitismus kein gesamtdeutsches, sondern ein sogenanntes “migrantisches” Problem.
Ich möchte deshalb heute an die Opfer jeglicher Gewalt erinnern. An alle, die in kriegerischen Konflikten getötet, in extremistischen oder terroristischen Anschlägen ermordet wurden. Und ich möchte nach vorne blicken: Denn Versöhnung und Frieden kann es nur geben, wenn wir gemeinsam jeden Tag dafür einstehen.
Bund fördert deutsch-baltischen Austausch mit weiteren 200.000 Euro
Während der Sitzung der Parlamentarier*innen zum diesjährigen Haushaltsverfahren haben die Abgeordneten Änderungen am Haushaltsentwurf für 2024 vorgenommen und 200.000 Euro zusätzlich für die in Lüneburg ansässige Deutsch-Baltische Zukunftsstiftung beschlossen. Damit setzt die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ein Signal für eine Stärkung des Austauschs zwischen Deutschland und den baltischen Ländern.
Jakob Blankenburg:
Es ist eine große Bereicherung für Lüneburg, dass durch die Deutsch-Baltische Zukunftsstiftung von hier aus interkulturelle Projekte zur Verständigung auf den Grundlagen von Demokratie und Menschenrechten entstehen. Gerade in Zeiten des Krieges in der Ukraine und einer gefährdeten Demokratie ist das besonders wichtig. Als Abgeordneter der Region freue ich mich sehr, dass wir diese bedeutende Arbeit jetzt unterstützen können.
Meine Kollegin aus der SPD-Bundestagsfraktion, die haushaltspolitische Sprecherin und Neuruppiner Bundestagsabgeordnete Wiebke Papenbrock, hat das Ergebnis mitverhandelt.
Wiebke Papenbrock:
Die Deutsch-Baltische Zukunftsstiftung ist ein wichtiger Brückenbauer zwischen Deutschland und dem Baltikum. Sie richtet Jugendkonferenzen aus, unterstützt bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und hilft, dass sich junge Menschen aus Deutschland, Estland, Lettland und Litauen untereinander vernetzen können. Das ist es, was wir in diesen politisch schwierigen Zeiten umso mehr brauchen. Deshalb freue ich mich sehr, dass es uns im Zuge der Haushaltsberatungen gelungen ist, 200.000 Euro zusätzlich für die wichtige Arbeit der Deutsch-Baltische Zukunftsstiftung zu beschließen.
Die Deutsch-Baltische Zukunftsstiftung setzt sich für den Erhalt und die Erforschung der deutsch-baltischen Kultur und die Förderung der Völkerverständigung ein. Ein Teilprojekt der in Lüneburg ansässigen Stiftung ist das Deutsch-Baltische Jugendwerk, das unter anderem mit regelmäßigen Jugendkonferenzen einen wichtigen Beitrag zum Austausch zwischen jungen Europäer*innen aus Deutschland und den baltischen Ländern leistet.
17.11.2023
Bund gibt 30 Millionen Euro für neue Sirenenförderung frei
Im Notfall zählt jede Minute: In Krisen oder bei Katastrophen muss die Bevölkerung schnell und zuverlässig gewarnt werden, um sich in Sicherheit bringen oder Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Auch wenn zunehmend neue Methoden wie SMS-Benachrichtigungen oder Warn-Apps Verbreitung finden, werden Sirenen als etabliertes und zuverlässiges Warnmittel auch in Zukunft eine große Rolle spielen.
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat nun Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro freigegeben, um den Ausbau der Sireneninfrastruktur im Land weiter voranzutreiben. Ziel des neuen Förderkonzepts ist es, dass Bund und Länder zügig die Lücken schließen und gemeinsam ein flächendeckendes und zukunftsfähiges Sirenennetz aufbauen.
Nach dem bundesweiten Warntag am 14. September 2023 hat die für den Zivilschutz zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) positive Bilanz gezogen: 97 Prozent der Bevölkerung wurden mit dem sogenannten Warnmittelmix erreicht. Dennoch besteht bei der Sireneninfrastruktur Nachholbedarf. Viele Anlagen wurden in den vergangenen 30 Jahren ausgemustert, bestehende Sirenen müssen nachgerüstet oder an die inzwischen digitalisierte Warninfrastruktur angeschlossen werden.
Behörden von Bund und Land sollen schnell Warnungen auslösen können
Die Mittelfreigabe im Haushaltsausschuss ist eine gute Nachricht für unsere Kommunen und Landkreise. Die Ampelkoalition möchte den Investitionsstau in unserem Sirenennetz zügig beheben, deshalb hat sie in den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr, neben zusätzlichen Mitteln für die SMS-Warnung, auch 30 Mio. Euro für ein neues Sirenen-Förderprogramm bereitgestellt. Zuständig für die Warnung im Katastrophenfall sind aber die Bundesländer. Deshalb wurden die Gelder gesperrt und an die Auflage geknüpft, dass die Länder sich finanziell am Förderprogramm beteiligen.
Das nun vorgelegte und vom Haushaltsausschuss abgesegnete Konzept sieht vor, dass Bund und Länder künftig zu gleichen Teilen Mittel bereitstellen. Neue oder modernisierte Sirenen sollen an das digitale Warnsystem angeschlossen werden, sodass auch Bundes- und Landesbehörden schnell Warnungen auslösen können. Außerdem wird ein Warnmittelkataster aufgebaut. Bereits 2021 wurde ein erstes Förderprogramm des Bundes im Umfang von 88 Mio. Euro aufgesetzt. In der Folge hatten viele Bundesländer ihre eigenen Anstrengungen, die Warninfrastruktur auszubauen, zurückgefahren.
09.11.2023
Ausstellung in Lüneburg bringt Besucher*innen Demokratie nahe
Mit ihrer Ausstellung "Demokratie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen" in der BBS III macht die Friedrich-Ebert-Stiftung darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich aktiv für den Erhalt der Demokratie einzusetzen.
Mein ganzes bisheriges Leben bin ich mit dem Gefühl aufgewachsen, in einem demokratischen Land zu leben, in dem wir unsere Meinung grundsätzlich frei äußern können. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die Demokratie in Europa oder gar in Deutschland noch einmal ernsthaft in Gefahr geraten könnte.
Populist*innen bekommen bei Wahlen mehr Zulauf, ohne echte Lösungen im politischen Wettbewerb anzubieten. Wir haben komplexe Probleme zu lösen, von Pandemien bis zum Aufhalten des ansonsten rapide Fortschreiten des Klimawandels. Diese Probleme lösen wir nicht durch mehr oder weniger qualifizierte Meinungsäußerungen, hier führt kein Weg an Maßnahmen auf rationaler wissenschaftlicher Basis vorbei.
Mit scheinbar einfachen Lösungen kommen wir nicht mehr weiter, denn die Antworten auf die Fragen, die sich heute stellen, sind nicht immer schwarz oder weiß. Nicht das lauteste Argument ist auch das beste. Demokratie bedeutet, gemeinsam um Lösungen zu ringen. Auch den anderen etwas zuzugestehen. Das ist unbequem, das macht Arbeit, aber nur so können wir die besten Lösungen finden.
Aus reinem Protest wählen ist falsches Signal
Natürlich ist Protest ein wesentliches Merkmal unserer Demokratie. Ohne diesen wären viele Entscheidungen der Politik, von Datenschutz bis Atomenergie, nicht angepasst oder korrigiert worden. Aus reinem Protest die Parteien zu wählen, die am meisten unser System infrage stellen, ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal, das unsere Demokratie ernsthaft gefährden könnte.
Neben den Protestwähler*innen nimmt offenbar auch die Zahl derer zu, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Ausgerechnet in unserer Region siedeln sich verstärkt “völkische Siedler” an, die uns mit ihrer Weltsicht in die 1930er Jahre zurückführen wollen. Hass, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit – das brauchen wir nicht noch einmal!
Umso wichtiger sind Ausstellungen wie diese, um uns Demokratie als täglich zu erarbeitenden Prozess nahe zu bringen. Es reicht nicht, einfach nur alle vier bis fünf Jahre zu wählen, wir müssen uns aktiv für den Erhalt der Demokratie und gegen Rechtsextremismus einsetzen.
07.11.2023
Apotheken in der Region müssen entlastet werden
Die Gesundheitsversorgung in Lüneburg und Lüchow-Dannenberg liegt mir sehr am Herzen. Deshalb habe ich nach einem Runden Tisch im August dieses Jahres mit Vertreter*innen der Apotheken in der Region erneut den Austausch gesucht und die Landwehrapotheke in Reppenstedt besucht. Fachkräftemangel, Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten, finanzielle Belastungen und steigende Ansprüche stellen die Apotheker*innen vor große Herausforderungen.
Es ist nicht akzeptabel, wenn in Deutschland beispielsweise Fiebersäfte für Kinder knapp werden. Mit dem Lieferengpassgesetz hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits erste Verbesserungen auf den Weg gebracht. Damit wird die Medikamentenproduktion zurück nach Europa verlagert, bürokratische Hürden werden abgeschafft und pharmazeutische Dienstleistungen sowie Prävention der Apotheken gestärkt.
Zu einer guten Patient*innenversorgung gehören auch Apotheker*innen, die ordentlich bezahlt werden. In der Politik müssen wir dafür klare Perspektiven schaffen und so die bestmögliche Versorgung für unsere Bürger*innen gewährleisten.
30.10.2023
Hunderte Lüneburger*innen zeigen sich solidarisch mit Israel
Am vergangenen Sonntag sind mehrere Hundert Bürger*innen dem gemeinsamen Aufruf der demokratischen Lüneburger Parteien und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg gefolgt und haben ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht. Es freut mich zu wissen, dass so viele Menschen an der Seite Israels stehen.
Für mich als Organisator der Kundgebung steht klar: Es steht in unserer besonderen historischen und moralischen Verantwortung, die Überlebenden des Holocaust und ihre Nachfahren zu schützen. Israel hat das Recht frei von Angst, Terror und Gewalt leben zu können.
Der brutale Terrorangriff der islamistischen, palästinensischen Hamas trifft auch uns bis ins Mark. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für den bewaffneten Angriff auf ahnungslose Zivilist*innen, die Opfer eines nur vorgeschoben religiösen Hasses geworden sind. Die Hamas nimmt bewusst in Kauf, dass durch Gegenangriffe auf sie auch die Menschen in Gaza leiden. Sie schadet den Palästinenser*innen und trägt die Verantwortung für die aktuelle Eskalation.
Auch hier in Lüneburg müssen wir dafür sorgen, dass Jüdinnen und Juden friedlich leben können. In dieser Zeit bedeutet das leider, dass jüdische Institutionen besonderen Schutz benötigen und die Öffentlichkeit verstärkt über das Antisemitismus aufgeklärt und stärker dafür sensibilisiert werden muss. Es wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass Lüneburg eine Partnerschaft mit einer Israelischen Stadt eingeht. Dafür setze ich mich ein.
16.10.2023